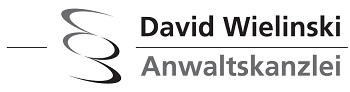Quelle: Beschlss des Bundesgerichtshofs vom 22.01.2025 – XII ZB 148/24
Der Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 22. Januar 2025 (XII ZB 148/24) betrifft die Frage der Leistungsfähigkeit eines Kindes beim Elternunterhalt, insbesondere in Bezug auf die Bemessung des Selbstbehalts nach Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.
Kernaussagen und Argumentation des BGH:
1. Ausgangssituation:
- Der Antragsteller (Sozialhilfeträger) verlangte vom Antragsgegner (Kind) Elternunterhalt, da die Mutter psychisch erkrankt war und Sozialhilfe bezogen hatte (ca. 61.663 € für 2020–2021).
- Der Antragsgegner hatte bereinigtes Einkommen von ca. 5.300 € netto/Monat.
- Amtsgericht und Oberlandesgericht wiesen den Antrag ab – mit der Begründung, der Antragsgegner sei nicht leistungsfähig, da sein Einkommen unter einem Selbstbehalt von 5.500 € liege.
2. Entscheidung des BGH:
- Der BGH hob den Beschluss des OLG München auf und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung zurück.
3. Zentrale Begründungen des BGH:
a) Kein Automatismus zwischen Sozialhilferecht und Unterhaltsrecht:
- Das Angehörigen-Entlastungsgesetz (2020) schließt Rückgriff auf Kinder mit Einkommen unter 100.000 €/Jahr zwar sozialhilferechtlich aus, ändert aber nichts an der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht.
- Zivilrechtliche Unterhaltspflichten bestehen weiterhin unabhängig von der Regressgrenze des § 94 Abs. 1a SGB XII.
b) Selbstbehalt von 5.500 € ist nicht haltbar:
- Die vom OLG angenommene Höhe überschreitet den tatrichterlichen Ermessensspielraum.
- Eine pauschale Anhebung des Selbstbehalts auf 5.500 € widerspricht der BGH-Rechtsprechung und würde faktisch die Regressgrenze auf über 100.000 € Einkommen anheben – was gesetzlich nicht gewollt ist.
c) Individuelle Ermittlung des Selbstbehalts:
- Der angemessene Selbstbehalt ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu bestimmen.
- Dies umfasst:
- Abzug vorrangiger Unterhaltsverpflichtungen
- Abzug berücksichtigungswürdiger Belastungen
- Belassung eines individuell bemessenen Betrags: ein Mindestselbstbehalt (z. B. 2.000 €) + ein Teil des überschießenden Einkommens
- Orientierung an der Düsseldorfer Tabelle und Leitlinien (z. B. Süddeutsche Leitlinien)
d) Anteil des einzusetzenden Mehrbetrags:
- Für Zeiträume nach Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes kann es vertretbar sein, dem Kind bis zu 70 % des sein Minimum übersteigenden Einkommens zu belassen.
- Der Rest kann zur Deckung des Elternunterhalts herangezogen werden.
e) Keine neue Bewertung von Abzügen (z. B. Altersvorsorge):
- Der BGH sieht keinen Anlass, von den bisherigen Kriterien zur Einkommensermittlung und -bereinigung beim Elternunterhalt abzuweichen.
Fazit:
Der BGH widerspricht der vom OLG München vorgenommenen pauschalen Anhebung des Selbstbehalts auf 5.500 € deutlich. Der Selbstbehalt muss konkret und einzelfallbezogen unter Berücksichtigung der individuellen Einkommens- und Lebensverhältnisse ermittelt werden. Eine pauschale Kopplung an die Einkommensgrenze des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ist nicht zulässig. Die zivilrechtliche Pflicht zum Elternunterhalt bleibt prinzipiell bestehen, auch wenn sozialhilferechtlich kein Regress erfolgt.